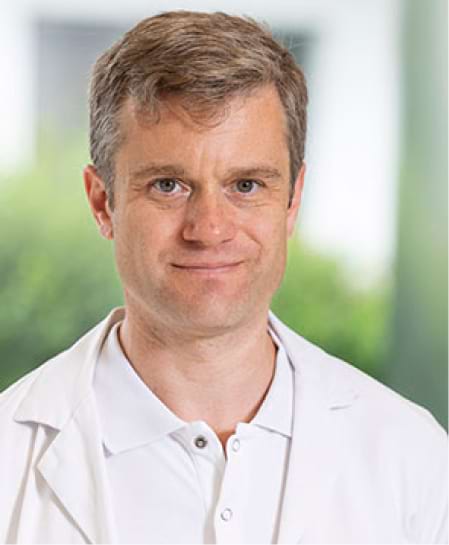Anamnese
Bei dem zu diesem Zeitpunkt 73 jährigen Patienten war im Jänner 2016 ein hepatal metastasiertes Adenokarzinom des Colon descendens diagnostiziert worden. Aufgrund der bestehenden Stenosesymptomatik erfolgte eine Hemikolektomie links. Dann wurde der Patient zur weiteren Therapieplanung vorgestellt. An Begleiterkrankungen erwähnenswert waren eine Polycythaemia vera unter zytoreduktiver Litalirtherapie und eine Osteoporose.
Prozedere
Es bestand ein linksseitiges kolorektales Karzinom im Stadium pT3,pN1,L1,V1,M1. Molakularbiologisch war RAS und BRAF Wildtyp festgestellt worden. Radiologisch waren vier hepatale Metastasen diagnostiziert worden, weitere Metastasen bestanden nicht. Im interdisziplinären Tumorboard wurde eine Induktionschemotherapie mit FOLFOX plus Panitumumab empfohlen. Nach vier Zyklen dieser Therapie wurde der Patient im Mai 2016 einer atypischen Segmentresektion im Bereich Segment V/VIII und Segment II/III unterzogen. Pathologisch wurde eine vollständige Resektion der Metastasen mit sehr gutem Ansprechen (Tumorregressionsgrad I-II nach Rubbia Brandt) auf die präoperative Therapie beschrieben. Postoperativ wurden acht Zyklen FOLFOX verabreicht und der Patient anschließend in das Nachsorgeprogramm übernommen.
Im Dezember 2016 wurde eine 5mm im Querdurchmesser haltende, neuaufgetretene hepatale Metastase festgestellt und reseziert.
Im Juni 2018 wurde ein singulärer, suspekter retroperitonealer Lymphknoten exzidiert und entpuppte sich als Metastase.
Im Jänner 2019 wurden in einer PET-CT multiple größenprogrediente und FDG avide intraabdominelle Lymphknoten, sowie ein größenprogredienter intrapulmonaler Rundherd festgestellt. Somit bestand eine klare Indikation zur palliativen Erstlinientherapie. Vor Therapiestart erfolgte die Bestätigung des RAS- und BRAF-Status, beides Wildtyp, aus dem 2018 resezierten retroperitonealen Lymphknoten. Aufgrund des ausgezeichneten pathologischen Ansprechens auf FOLFOX und Panitumumab im Rahmen der Induktionstherapie 2016 erhielt der Patient dasselbe Schema ab Februar 2019. Nach insgesamt 12 Zyklen wurde im August 2019 hinsichtlich der radiologisch bestätigten Krankheitskontrolle eine Therapiepause beschlossen. Der Patient war in einem guten Allgemeinzustand und hatte die Therapie, abgesehen von einem akneiformen Rash Grad III, der eine Panitumumab-Dosisreduktion notwendig gemacht hatte, gut vertragen.
Die Krankheitsstabilisierung hielt bis Dezember 2020 an, dann musste aufgrund einer Tumorprogression eine erneute systemische Therapie eingeleitet werden. In Hinblick auf das wiederholt gute Ansprechen auf die anti-EGFR Therapie wurde Panitumumab, in reduzierter Dosis, begonnen, allerdings kombiniert mit FOLFIRI, um der kumulativen Neurotoxizität von Oxaliplatin Rechnung zu tragen. Es konnte erneut eine Krankheitsstabilisierung erreicht werden. An Nebenwirkungen trat wieder ein akneiformer Rash auf, weshalb im 9. Zyklus einmalig Panitumumab ausgesetzt werde musste. Nach 12 Zyklen und einem onkologischen stabilen Befund, allerdings zunehmender chemotherapieassozierter Fatigue wurde mit dem Patienten ab Juli 2021 eine Therapiepause vereinbart.
In regelmässigen Kontrollen wurde bis April 2023 keine weitere Progression festgestellt. Im Falle einer Progression wäre als erster Schritt eine Rebiopsie eines progredienten Herdes zu empfehlen. Wäre der Tumor nach wie vor RAS und BRAF Wildtyp, könnte eine neuerliche anti-EGFR Therapie empfohlen werden.